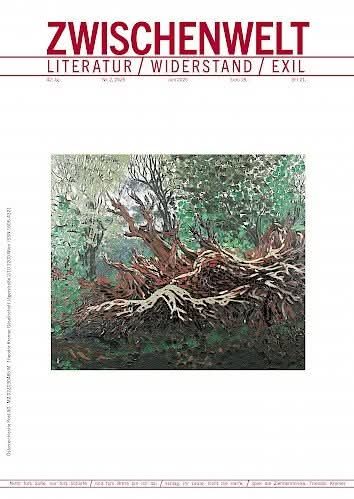
Literaturzeitschrift Zwischenwelt
Juni 2025
Buchbesprechung von Hedwig Wingler
Sandra Pioro: ---"Nie mehr still. Die Reise zu mir selbst. Eine jüdische Geschichte.“
edition keiper, Graz 2025. 310 Seiten.
Der Titel erklärt sich beim Lesen: Sandra ist zu lange still gewesen, ohne Fragen und daher ohne Antworten. Die 1968 – in Stuttgart - geborene Verfasserin des Buches schaut auf ihr Leben, ihre Herkunft und findet in intensiver Suche vieles; es werden Erinnerungen geweckt, was die eigene Vergangenheit betrifft. Es werden Quellen gefunden auf der Suche nach Herkunft und Zukunft ihres Vaters. Der Dreh- und Angelpunkt: Das vierjährige Mädchen verliert den Vater, der die Familie – seine Frau, Sandra und ihre zwei Brüder – verlässt. Warum, wohin, was war vorher, was kommt noch.
Dreißig Abschnitte schildern, wie das Stillhalten besiegt wird; die Geschichte der Familie und vor allem die des Vaters wird erzählt, beleuchtet, rekonstruiert? – jedenfalls für die Autorin greifbar gemacht. Es ist ihr erstes Buch, sprachlich-stilistisch und im Aufbau hervorragend gelungen.
Das Schweigen ist ihr in der Kindheit beigebracht worden. „Die Neugierde duelliert sich mit der Angst. Ich zögere und hadere mit dem Fremden. Letztendlich gewinnt jedoch die Sehnsucht, die sich in meinem Inneren breitmacht und nach den Erinnerungen und Wahrheiten sucht, die allzu lange wie auf einem Meeresgrund verschollen schienen.“ (S. 21) Die Vergangenheit muss auftauchen, aus der Tiefe des Wassers, des Meeres des Vergessens; diese Metapher des Tauchens, des Tauchganges durchzieht das Buch, sie wird als Methode verwendet und so wird aus tagebuchartigen Notizen ein Stück Literatur, mitsamt den Inhalten, die mit den Verbrechen der NS-Zeit gefüllt sind.
Sandras Familie gehörte in Stuttgart zu einer konservativen jüdischen Gemeinde, die Synagoge wurde besucht, jüdische Feste wurden gefeiert. Die Mutter hat die Zeit der Verfolgung glücklich überstanden. Doch der aus der polnischen Stadt Sosnowiec stammende Vater Samuel Pioro, 1926 geboren, war ein Überlebender aus Auschwitz. Noch kurz vor der Befreiung dieses Vernichtungs-KZs durch die Sowjetarmee am 27. Januar 1945 wurde der Vater auf den Todesmarsch in das KZ Buchenwald geschickt. Dieses Schicksal teilte auch Jossele, sein polnischer Freund seit Auschwitz. Sie kamen beide dann auf Umwegen nach Stuttgart. Auch nachdem der Vater die kleine Sandra und die Familie verlassen hatte, blieb Jossele im Nebenhaus der Familie wohnen als Nachbar, bis er vor einigen Jahren starb. Er hatte dem Mädchen erzählt, dass er das KZ nur mit der Hilfe Samuels überstand.
Dass Sandra Jüdin war, war zunächst kein Thema unter den Mitschülern, allerdings wurde sie aus dem christlichen Religionsunterricht ausgeschlossen. Auch sollte sie am Geschichtsunterricht nicht teilnehmen, wenn die Zeit des Nationalsozialismus durchgenommen wurde. Zwei antisemitische Erlebnisse erschüttern Sandra – als Gymnasiastin; doch es dauert Jahrzehnte, bis sie tatsächlich anfängt zu fragen und zu forschen.
Das „Tiefseetauchen“ soll helfen. „Ich bin nervös und spüre, dass mein Puls sich erhöht. Das Meer ist wieder einmal unruhig und ich tauche durch gefährliche Gewässer. . .“ (S. 95) Die Erzählung verläuft nicht chronologisch. Sie setzt ein mit dem Entschluss der Autorin, nachzuforschen. Da lebt sie schon in Graz, wohin sie auf Umwegen vor einiger Zeit gekommen ist. In Wien hatte sie Schauspiel studiert. Als Schauspielerin hat sie viele Jahre an Theatern vor allem in Stuttgart, Wien und Graz gearbeitet, später auch als Modedesignerin. Diese Fähigkeiten nutzte sie in Folge auch dazu, für den Verein „Rote Nasen“ Österreich zu arbeiten, wo sie heute eine leitende Funktion in der Kunst innehat.
Viele der Abschnitte gestaltet sie so, dass durch das „Tauchen ins Vergangene“ und „Auftauchen in die Gegenwart“ wie aus einem Traum Schritt für Schritt schlüssig das Verschüttete „hervorkommt“.
Es ist hier nicht möglich, die Details dessen wiederzugeben, was Sandra über den Weg des Vaters nach der Befreiung erfährt. Eine Quelle ist jedoch zu erwähnen: Arolsen Archives in Hessen, das umfangreichste Archiv der NS-Verfolgten.
Demnach kam Samuel Pioro, wie sein Freund Jossele, von Auschwitz über das KZ Buchenwald zunächst im Juli 1945 nach Innsbruck- Reichenau. Die US-Amerikaner nannten die Überlebenden „Displaced Persons“. „Die Deutschen nannten sie später: heimatlose Ausländer“ (S. 170) Von Reichenau ging es für beide Männer bald nach Bayern, nach Föhrenwald in ein Lager, das als „jüdisches Schtetl“ für DPs zwölf Jahre lang eine Zuflucht blieb. Der Ort heißt heute Waldram in Wolfratshausen bei München. Nach etwa fünf Jahren zog der Vater nach Stuttgart, gründete die Familie. –
Was ihn betrifft, so galt er seit dem Jahr 1991 als „verschwunden“, verschollen. Es werden Einzelheiten seiner Tätigkeit, seiner „Geschäfte“, aus verschiedenen Richtungen bekannt. Samuel war mit dem Handel und auch mit dem Schmuggel von Diamanten befasst; dies war wohl der Grund für seine Reisen in viele Länder Europas und nach Brasilien. Wie die Tochter darauf reagiert? Sie will verstehen, als ihr der vier Jahre ältere Bruder Einzelheiten mitteilt, über die es sogar ein Buch von 1975 gibt. Ist es schmerzhaft für sie, oder soll sie verständnisvoll sein? Sie wertet nicht.
Die letzte Station auf der Suche nach der Vergangenheit führt nach Polen im Jahr 2024. „Tief unten im Meer schwimme ich auf der letzten Etappe meinem Ziel entgegen. . .“ (S. 270) Es gelingt ein Kontakt mit einem polnischen Helfer, der Sandra zunächst nach Sosnowiec, in die Heimatstadt des Vaters, führt. Dort gibt es keine Verwandten, die überlebt hätten. Durch Arolsen Archives hatte sie bereits auf ihrer Suche erfahren, dass ein Großcousin überlebt hatte und nach Chicago ausgewandert war.
Sandra durchwandert die Stadt und gelangt zum jüdischen Friedhof, auf dem ihr Großvater Dawid, der „Kolonialwarenhändler“, bestattet war; einen Grabstein findet sie nicht. Dann fährt sie nach Auschwitz-Birkenau, es ist eine Zugstunde entfernt. - Wie die Tochter ihre Reaktion auf den Leidensweg des Vaters beschreibt, ist bewegend – sie versachlicht die Darstellung bewundernswert, als schaue sie von außen auf die schrecklichen Umstände. Es wird in dieser Besprechung darauf verzichtet, hier ins Detail der Tatsachen und der Gefühle zu gehen, mit denen die Autorin konfrontiert wird.
Vor einigen Jahren, so am Ende ihrer Geschichte, legte sie die deutsche Staatsbürgerschaft ab und wurde Österreicherin. Dass sie bis etwa zum achten Lebensjahr als „staatenlos“ galt nach dem Vater, erwähnt sie beiläufig.
Mit dem Buch von Sandra Pioro liefert der Grazer Verlag edition keiper nicht nur eine besondere Familiengeschichte, sondern auch ein wichtiges literarisches Dokument unserer Zeit.
Hedwig Wingler

FAZIT MAGAZIN
Ausgabe Juli/August 2025
Fazitbegegnungen
Volker Schögler trifft auf Sandra Pioro
Die Seelentaucherin
Sandra Pioro hat sich auf eine Reise zu sich selbst begeben. Aus der Reise wurde nach 22 Monaten der Schreibarbeit und Selbstreflexion, auf Tauchgängen in die Tiefen ihrer Seele und ihrer Träume, aber auch physisch auf den Spuren ihrer Vorfahren im In- und Ausland sowie in internationalen Suchdiensten und Archiven gegen das Vergessen ein Buch: „Nie mehr still“, Untertitel: „Die Reise zu mir selbst. Eine jüdische Geschichte.“ Es ist eine Aufarbeitung der Traumata der sogenannten Kriegsenkel, jener Generation, die den Krieg, den Nationalsozialismus, den Holocaust, die Angst und das Grauen nicht selbst erlebt hat. Die aber unter diffusen Symptomen, vor allem Ängsten leidet, deren Ausgang die neurowissenschaftliche Forschung in der Epigenetik, der generationsübergreifenden Vererbung von Traumata, verortet – was sowohl für die Täter- wie auch die Opferseite gilt. Auch das bleierne Schweigen über jene Zeit betrifft beide Seiten, wenn auch oft in unterschiedlicher Ausformung und weil Verfolgung zumindest im Sinne von Ausgrenzung in Gestalt von Antisemitismus noch immer stattfindet. Wie auch die Angst davor. Diese Erfahrung musste die Autorin bei einigen Buchhandlungen machen ,die das Buch zwar loben, sich aber nicht getrauen, weitergehende Promotion zu machen. Erschütternd ist auch ihre Schilderung im Buch, wie die Auslagenscheiben ihres Ateliers in einem durchwegs vornehmen Grazer Stadtviertel mit Hakenkreuzen beschmiert wurden und ein zufällig vorbeikommendes Ehepaar spontan die Reinigungsarbeit übernommen hat.
In ihrem schonungslos autobiographischen Roman, erkennt Sandra Pioro, dass sie ihre Vergangenheit beleuchten und jene Fragen stellen muss, die in ihrer Familie bislang vermieden wurden. So begibt sie sich auf Spurensuche, um die vielen offenen Fragen nach ihrem Vater zu klären, der als Jugendlicher mehrere Konzentrationslager überlebt hat und 1991 spurlos verschwunden ist. Die Begegnung mit ihrer jüdischen Geschichte und den Traumata ihrer Eltern und Großeltern lässt sie ihre Identität finden: als Tochter eines Ausschwitz-Überlebenden, als Künstlerin und als jüdische Frau. Der Abgrund des familiären Schweigens über die Vergangenheit seit ihrer Kindheit in Stuttgart formte auch sie selbst zu einer schweigenden Person, zumal wenn sie sich mit Antisemitismus konfrontiert sah. Sich niemandem anzuvertrauen verstärkte ihr Gefühl, weniger wert und nicht erwünscht zu sein. In ihrem Buch trifft Sandra Pioro einen zugleich stimmungsvollen wie spannenden Ton, der auf erschreckend schlüssige Weise vergangene und gegenwärtige Sachverhalte und Tatbestände widerspiegelt. Fantasiegebäude, unglaubliche Träume und merkwürdige Zufälle scheinen nur solange zweifelhaft, bis sie selbst schreibt: „Würde ich eine fiktive Geschichte schreiben, hätte ich es anders gestrickt, denn das käme mir zu glatt vor, um es glaubwürdig wirken zu lassen. Das Leben hat offensichtlich seine eigenen Gesetze und schreibt sich seinen eigenen Roman.“ Sandra Pioro ist Absolventin des ehemaligen Konservatoriums der Stadt Wien (Musikalisches Unterhaltungstheater, Gesang, Musical), debütierte im Wiener„Ronacher“, war zuletzt bis zum Jahr 2000 Ensemblemitglied bei den Vereinigten Bühnen Graz und betrieb anschließend ein eigenes Modelabel. Heute ist sie bei den „Roten Nasen“ Leiterin des Coaching-Teams und der Abteilung Kostüm und Ausstattung. Mit der Veröffentlichung der eigenen Geschichte hat sie das Schweigen durch das Wort ersetzt, „um letztendlich diejenige zu sein, die ich eigentlich geworden wäre.“ Was nach dem Buch für sie anders sei? „Ich war früher die Suchende und habe jetzt diese Lücke in meiner Geschichte geschlossen, nun habe ich so eine Ruhe gekriegt, eine Art innere Stärke und Selbstbewußtsein.“ Das darf auch für die Autorin Sandra Pioro gelten, die wunderbar mit der geschriebenen Sprache umzugehen versteht, was eine Fortsetzung geradezu einfordert.